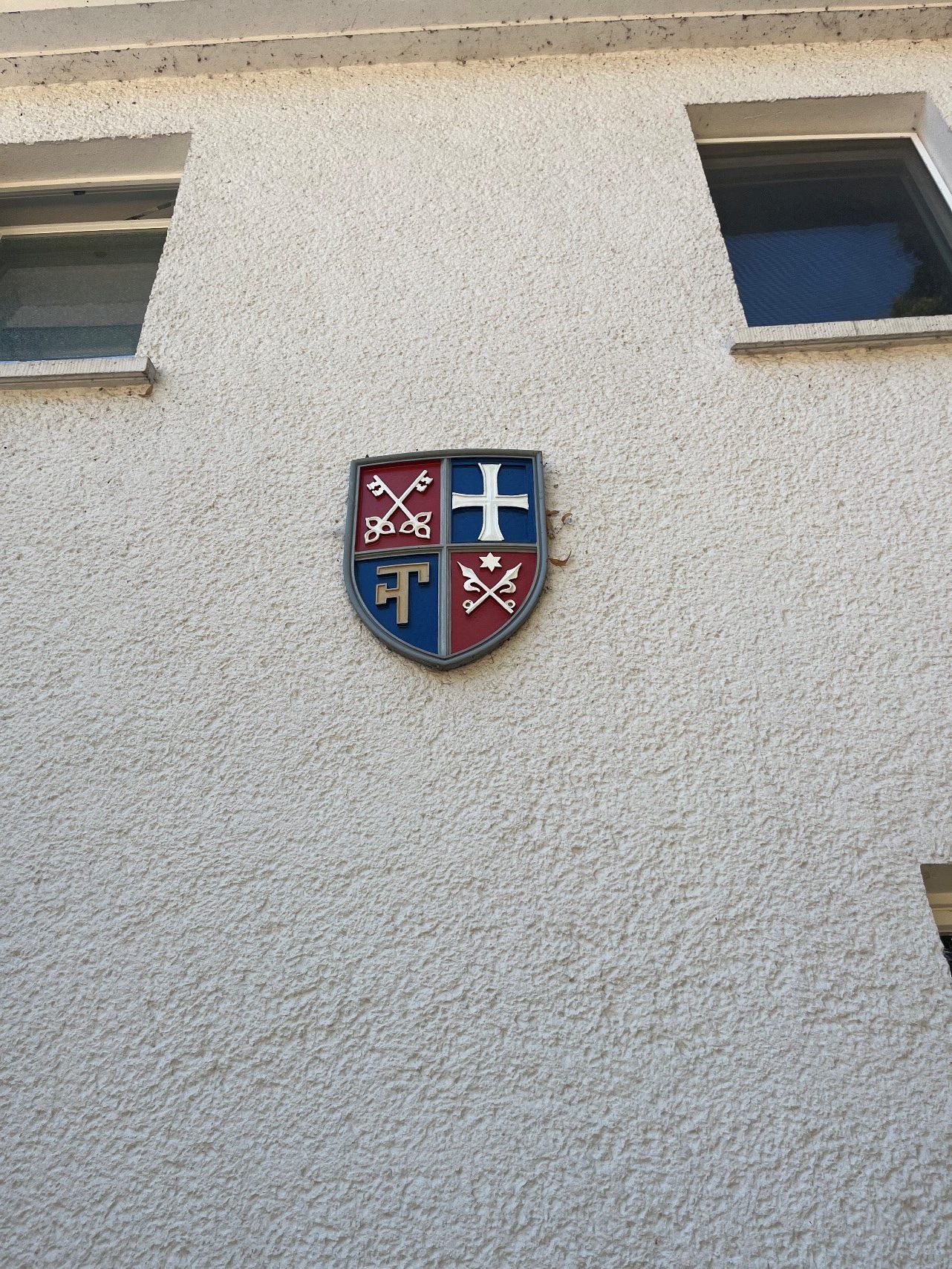Der Peetzsee - Ein See zum Staunen und Entdecken
Das Grundstück des Christian-Schreiber-Hauses liegt direkt am Peetzsee. Er ist ein langer, ruhiger See mitten in Grünheide, nicht weit von Berlin entfernt. Der Peetzsee gehört zu einer Seenkette – das heißt: Er ist mit anderen Seen verbunden, wie mit dem Möllensee und dem Werlsee. Das Wasser fließt durch kleine Kanäle weiter in die Löcknitz und schließlich in die Spree.
Der Peetzsee ist ziemlich groß – ungefähr so groß wie 85 Fußballfelder! An manchen Stellen ist er sehr tief, an anderen ganz flach. Besonders schön ist das Strandbad am Ufer. Dort gibt es einen abgetrennten Bereich zum Schwimmen, in dem auch Kinder sicher planschen können. Am Strand kann man gut picknicken oder Ball spielen. Es gibt sogar ein Volleyballfeld und direkt daneben einen Campingplatz.
Auch auf dem Wasser ist viel los: Viele Menschen kommen zum Paddeln oder fahren mit dem Stand-Up-Board. Wenn Du gerne angeln willst, bist Du hier genau richtig – im Peetzsee schwimmen viele verschiedene Fische: Hechte, Barsche, Karpfen und sogar Welse.
Rund um den See führt ein Weg, der etwa fünfeinhalb Kilometer lang ist. Perfekt für einen Spaziergang mit der Familie! Unterwegs kannst Du Vögel beobachten, Boote entdecken oder einfach den Blick aufs Wasser genießen.
Der Peetzsee ist also ein richtiger Lieblingsort: Zum Spielen, Schwimmen, Wandern oder einfach zum Staunen. Und das Beste ist – er ist ganz nah!